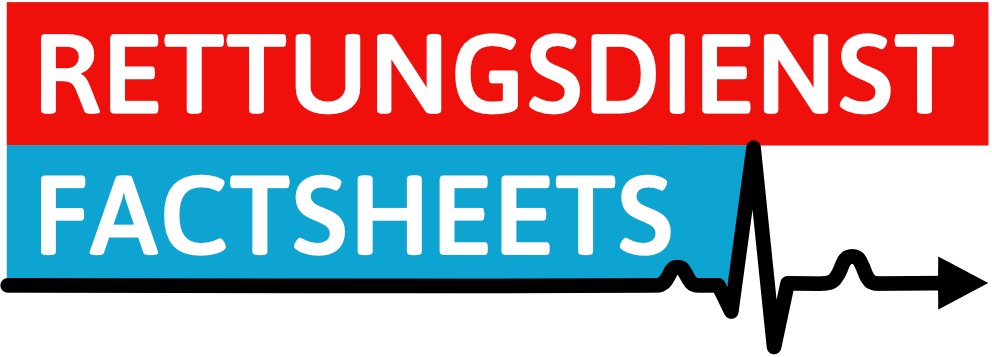Die Endometriose ist eine gutartig chronisch Erkrankung, bei der funktionsfähiges Endometrium–ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst (Endometrium = Gebärmutterschleimhaut). Am häufigsten tritt dies an Ovarien, Eileitern, Peritoneum, Darm, Harnblase und seltener an extraperitonealen Stellen auf.
Die Erkrankung betrifft etwa 10 – 15 % aller gebärfähigen Frauen (häufig zwischen dem 25. – und 35. Lebensjahr), ist häufig unterdiagnostiziert und kann mit starken Schmerzen und einem unerfüllten Kinderwunsch einhergehen.
Für den Rettungsdienst ist die Endometriose relevant, da sie bei Patientinnen im gebärfähigen Alter eine häufige, aber oft übersehene Ursache für akute abdominelle Schmerzen darstellen kann. Die Symptome können sich wie ein gynäkologischer, urologischer oder gastrointestinaler Notfall präsentieren.
Ursache #
Die Ursachen der Endometriose sind nicht vollständig geklärt. Es handelt sich um eine multifaktorielle Erkrankung, bei der mehrere Theorien diskutiert werden. Am wahrscheinlichsten ist eine Kombination aus verschiedenen Aspekten der diskutierten Theorien:
- Transplantationstheorie: Menstruationsblut fließt durch die Eileiter in die Bauchhöhle. Das aktive Endometrium implantiert sich anschließend im Peritoneum.
- Metaplasietheorie: Peritoneale Zellen wandeln sich unter hormonellem Einfluss in endometriumähnliches Gewebe um.
- Induktionstheorie: Kombination aus Transplantations- und Metaplasiertheorie
- Lymphogene und hämatogene Streuung: Endometrioseherde an entlegenen Stellen (z. B. Lunge) könnten durch lymphogene oder hämatogene Streuung entstehen.
- Genetische Prädisposition: Familiäre Häufung spricht für einen genetischen Einfluss, bisher konnte jedoch kein spezifisches Gen identifiziert werden.
- Immunologische Faktoren: Verminderte Immunabwehr verhindert die Beseitigung ektopischer Endometriumzellen.
Es gibt keine spezifischen infektiösen Ursachen oder Erreger, eine Endometriose ist nicht infektiös oder ansteckend.
Risikofaktoren #
Es konnte einige Risikofaktoren für das Auftreten der Endometriose identifiziert werden. Da die Ursachen der Erkrankung aber noch nicht vollständig erforscht sind, sind auch die Risikofaktoren nicht als abschließend anzusehen.
Als Hauptrisikofaktor gilt die die Menstruation an sich, wobei festgestellt werden konnte, dass Frauen welche ihre Menstruation durch hormonelle Präparate unterdrücken einem geringeren Risiko für das Auftreten der Erkrankung ausgesetzt sind. Weitere Risikofaktoren sind vorhergegangene Eingriffe an der Gebärmutter, Adipositas sowie eine erste späte Schwangerschaft. Zudem wird eine familiäre Prädisposition angenommen (siehe oben).
Symptome #
Das Leitsymptome der Endometriose sind starke, krampfartige Schmerzen während des Menstruationszyklus. Die Symptome sind allerdings nicht spezifisch und können je nach Patientin stark abweichen, weshalb eine genaue Anamnese eine hohe Bedeutung hat. Die Symptome treten gehäuft und verstärkt während des Menstruationszyklus auf.
- starke Regelschmerzen, tlws. therapierefraktär (Dysmenorrhoe)
- verlängerte und verstärkte Menstruation
- chronische Unterbauch- und Rückenschmerzen
- Übelkeit
- schmerzhafte Miktion und Stuhlgang (Dysurie & Dyschezie)
- schmerzhafter Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)
- unerfüllter Kinderwunsch
- zyklische Beschwerden außerhalb des Uterus
Therapie #
In der präklinischen Versorgung steht die symptomorientierte Therapie gemäß dem ABCDE-Schema im Vordergrund. Da die Endometriose nicht primär vital bedrohlich, aber extrem schmerzhaft ist, muss das Hauptaugenmerk auf einer effektiven Analgesie liegen.
Die Lagerung sollte durch die Patientin selbstständig gewählt werden, alternativ kann eine bauchdeckenentspannende Lagerung angestrebt werden.
Eine genaue Anamnese des Zyklus kann Hinweise auf eine Endometriose verstärken, eine Schwangerschaft sollte anamnestisch stets ausgeschlossen werden (CAVE: Analgesie bei Schwangerschaft).
Es sollte stets der Transport in eine Klinik mit gynäkologischer Fachabteilung angestrebt werden.
Medikamente #
Zur analgetischen Behandlung von Regelschmerzen werden durch Patientinnen freiverkäufliche Analgetika wie Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Ibuprofen oder Metamizol eingesetzt. Bei Koliken wird zusätzlich Butylscopolamin angewendet.
Diese Therapie kann durch den Rettungsdienst übernommen oder fortgesetzt werden, wobei die täglichen Maximaldosen beachtet werden müssen. Bei extremen Schmerzen kommt aber auch der Einsatz von Opioiden gemäß der regionalen Vorgaben in Betracht.
| Metamizol oder | 1 g i.v. als Kurzinfusion oder |
| Paracetamol (Perfalgan®) | 1 g i.v. als Kurzinfusion |
| bei Koliken in Kombination mit | bei Koliken in Kombination mit |
| Butylscopolamin | 20 – 40 mg i.v. (max. 100 mg) |
Differentialdiagnostik #
- Appendizitis
- Divertikulitis
- Extrauteringravidität
- Ileus
- Ovarialtorsion
- Zystenruptur
Quellen #
- A. Nattermann & Cie. GmbH. (2024, November). Fachinformation: Novalgin® 1 g-Injektionslösung.
- A. Nattermann & Cie. GmbH. (2022, Juli). Fachinformation: Buscopan® Ampullen.
- Ballweg, M. L. (2004). Impact of endometriosis on women’s health: comparative historical data show that the earlier the onset, the more severe the disease. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 18(2), 201–218. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2004.01.003
- Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG). (2020). S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Endometriose. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/015-045
- Fresenius Kabi Deutschland GmbH. (2025, Januar). Fachinformation: Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung.
- Janni, W., Hancke, K., Fehm, T., Scholz, C. & Rack, B. K. (2021). Facharztwissen Gynäkologie (3. Aufl.). Elsevier.
- Kippnich, M. & Walles, T. (2014). Der „akute Thoraxschmerz“ beim jungen Erwachsenen. Notarzt, 30(05), 218–221. https://doi.org/10.1055/s-0033-1360015
- Strauss, A., Sanders, L., Alkatout, I., Meinhold-Heerlein, I., Gräsner, J. & Strauss, C. (2014). Mütterliche Notfälle während der Schwangerschaft. Frauenheilkunde Up2date, 8(01), 61–80. https://doi.org/10.1055/s-0032-1324989