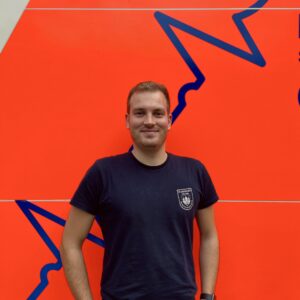Im Vorfeld von Kindernotfällen sollte auf Anfahrt immer eine aktive Vorplanung und Teambesprechung erfolgen. Hierzu bietet es sich an, Hilfsmittel, wie z.B. das KinderSicher oder die App PediHelper zu nutzen. Auch der oben verlinkte DBRD-Algorithmus kann helfen.
Auf Anfahrt sollten sich folgende Fragen gestellt werden, bzw. Aufgaben verteilt werden:
- Wer leitet das Team? (Hat ein Teammitglied mehr Erfahrung mit Kindern?; Traut sich ein Teammitglied die Teamführung nicht zu?; etc.)
- Was erwarten wir bei der Meldung? (Welches Krankheitsbild? Ist uns dieses bekannt? Benötigen wir (vermutlich) schnell Unterstützung?)
- Was für Werte erwarten wir beim Kind? (AF, Puls, HF, RR, Temp., etc.)
- Welche Medikamente benötigen wir vermutlich? Wie ist die richtige Dosierung?
An der Einsatzstelle sollte, bevor auf das Kind zugegangen wird, eine Türrahmendiagnose erfolgen. Hierzu bleibt das Rettungsteam im Türrahmen oder in einem gewissen Abstand zum Kind stehen und beurteilt es aus der Entfernung kurz. Diese Einschätzung sollte nur wenige Sekunden andauern. Als Hilfsmittel wird das Pädiatrische Dreieck angewandt, an dessen Ende die Einschätzung „krankes Kind“ bzw. „nicht-krankes Kind“ gleichbedeutend mit „kritisch“ bzw. „unkritisch“ steht. Sobald in einem der drei Bereiche ein negativer Punkt auffällt, ist das Kind als krank bzw. „kritisch“ einzuschätzen. Je nach Einschätzung wird das Kind unterschiedlich untersucht.

Wird das Kind als „kritisch“ eingestuft, erfolgt die Untersuchung von Kopf zu Fuß nach dem ABCDE-Schema. Beide Teammitglieder treten an das Kind heran und arbeiten mit dem Patienten.
Wird das Kind als „unkritisch“ eingestuft, erfolgt die Untersuchung des Kindes von Fuß zu Kopf. Hierdurch soll das Kind weniger Angst haben und es soll ein besseres Vertrauensverhältnis aufgebaut werden.
Es bietet sich bei Kindern an, bestimmte Untersuchungen durch die Eltern durchführen zu lassen, da das Kind zu diesen deutlich mehr Vertrauen hat. Diese Maßnahmen können z.B. das Fiebermessen oder die Anlage eines SpO2-Sensors sein.
Zur „Begrüßung“ von kleinen Kindern bietet sich die sogenannte „Initialberührung“ an Fuß/Bein/Schulter an. Hierzu wird das Kind einfach kurz berührt, bzw. die Hand wird aufgelegt, bis das Kind die Aufmerksamkeit auf das Teammitglied lenkt. Durch diese Begrüßung wird der Stressfaktor des Kindes enorm gesenkt.
Allgemein sollte versucht werden, bei der Arbeit mit kleinen Kindern, die Stressfaktoren so gering wie möglich zu halten. Die Eltern sollten deshalb immer in der direkten Nähe sein und für das Kind stets sichtbar sein. Sofern es möglich ist, sollte die Untersuchung nur durch ein Teammitglied erfolgen. Das andere Teammitglied sollte sich im Hintergrund halten, um das Kind nicht zu verunsichern. Es kann auch eine sinnvolle Taktik sein, die Einsatzjacke nicht mit an die Einsatzstelle zu nehmen (CAVE: EIGENSCHUTZ!). Die hellen, roten Farben wirken bedrohlich auf das Kind, da es in der Regel noch nicht mit dem Rettungsdienst in Kontakt gekommen ist.
TICLS-Schema
Neben dem Pädiatrischen Dreieck kann die Türrahmendiagnose auch alleine mit dem TICLS-Schema durchgeführt werden oder dieses wird in den Bereich Aussehen des Pädiatrischen Dreiecks eingebaut (Empfehlung EPC, siehe Grafik).
TICLS:
T = Tonus (Muskeltonus schlaff oder aktiv?)
I = Interaction (interagiert das Kind mit der Umwelt?)
C = Consolability (kann das Kind beruhigt werden?)
L = Look (fixiert es mich? wirkt es apathisch?)
S = Speech (klare Sprechweise, Wimmern / Stöhnen, Nebengeräusche?)
weitere Infos
Einen Blick sollten alle Interessierten auf das NAEMT EPC Kursprogramm werfen, dieses Kurssystem befasst sich ausschließlich mit Kindernotfällen und gibt Hilfestellungen für Personal, welches mit schwerkranken und verletzten Kindern in Kontakt kommen kann.
Quellen
- Gollwitzer, J. (2017, Juni 2). Kindernotfall – „don´t let you look like an idiot“. Abgerufen 14. Juni 2020, von https://foam-rd.health.blog/2017/06/02/kindernotfall-dont-let-you-look-like-an-idiot/
- Emergency Pediatric Care (EPC). (o. J.). Emergency Pediatric Care (EPC). http://www.epc-germany.de/