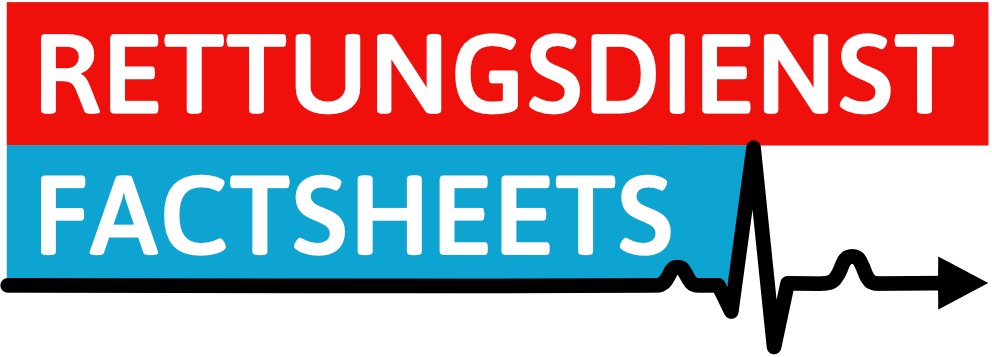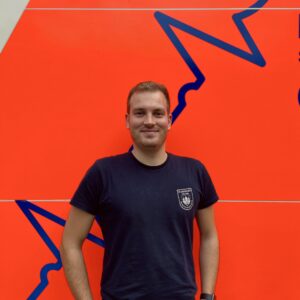Aufbau der Haut
Die Haut ist in verschiedene Schichten mit unterschiedlichen Funktionen aufgebaut. Diese sind von außen nach innen:
Epidermis (Oberhaut)
Die Epidermis ist die obere Hautschicht und dient vor allem den Schutz des Körpers, u.a. Schicht vor Eintritt von Fremdkörpern, UV-Strahlung etc. Sie besteht aus fünf verschiedenen Schichten, diese sind von außen nach innen:
- Stratum corneum (Hornschicht)
- Stratum lucidum (Glanzschicht)
- Stratum granulosum (Körnerschicht)
- Stratum spinosum (Stachelzellschicht)
- Stratum basale (Basalzellschicht)
Dermis / Korium (Lederhaut)
Das Korium liegt zwischen der Epidermis und der Subkutis. Es handelt sich um ein dichtes, reißfestes, aber dennoch dehnbares Bindegewebe. Zudem enthält diese Haftschicht Gefäße, Drüsen und Fasern. Das Korium ist noch einmal in zwei Schichten unterteilt:
- Stratum papillare (Papillarschicht)
In dieser Schicht liegen viele Kapillargefäße, sie beinhaltet zudem Rezeptoren und Nervenenden. Zudem entstehen hier Hautreliefe, wie z.B. der Fingerabdruck. - Stratum reticulare (Netzschicht)
Diese Netzhautschicht besteht auf Kollagenfasern und elastischen Fasernetzen. In diesem Bereich der Haut befindet sich Flüssigkeit, die die Straffheit der Haut bestimmt.
Subkutis (Unterhaut)
Die Subkutis beinhaltet Bindegewebe und Fettzellen. Sie dient als Energiespeicher und leisten eine Wärmeisolierung für den Körper. Zudem „polstert“ sie Venen und Arterien ein und beinhaltet Haarwurzeln und Nerven.

Aufgaben der Haut
Die Aufgaben der Haut können in drei Bereiche eingeteilt werden: Schutzfunktion, Stoffwechselfunktion und sensorische Funktion und Kommunikation.
- Schutzfunktion
- Eindringen von Mikroorganismen
- chemische Schäden
- Wärme- oder Wasserverlust
- Druck, Stöße und Reibung
- Kälte, Hitze und Strahlung
- Stoffwechselfunktion
- Ausscheidung durch Transpiration
- Einleitung der Vitamin-D-Synthese
- Speicherung von Fett als Strukturkomponente oder Energiereserve
- sensorische Funktion
- Wahrnehmung von Reizen
- Spiegel von vegetativen Reaktionen
- Gesichtsdiagnostik
Wundversorgung
Zur Wundversorgung kommen im Rettungsdienst verschiedene Materialien und Techniken zum Einsatz. Die wichtigsten werden im Folgenden kurz aufgelistet:
Wundauflage
Grundsätzlich wird eine Wunde immer mit sterilen Kompressen und Tüchern abgedeckt. Als Fixierung werden Fixier- oder Mullbinden genutzt. Häufig können auch Verbandpäckchen genutzt werden, dies ist eine Kombination aus Mullbinde und Kompresse. Bei Verbrennungen werden aluminiumbeschichtete Kompressen genutzt. Diese wirken neben dem Schutz vor Auskühlung zusätzlich bakteriostatisch und schützen vor Infektionen.
mechanische Blutstillung
Bei massiven Blutungen an Extremitäten, die durch einen alleinigen verband nicht zum Stillstand kommen, wird ein Druckverband angelegt. Dieser komprimiert die Wunde und sorgt für eine Blutstillung. Zum Anlegen eines Druckverbands wird lediglich eine sterile Kompresse, eine Fixierbinde und ein Druckpolster (z.B. verpackte Mullbinde) benötigt. Über einen Druckverband kann, sofern nötig, einfach ein zweiter Druckverband zur Verstärkung angelegt werden. Sollte der Druckverband keine Wirkung zeigen, oder aufgrund der Verletzung an den Extremitäten nicht anlegbar sein (z.B. Amputation), besteht die Möglichkeit der Anlage eines Tourniquets.
medikamentöse Blutstillung
Medikamentös können Hämostyptika eingesetzt werden, welche die Blutgerinnung aktivieren. Diese können als Wundauflage, z.B. in Form von getränkten Kompressen, direkt aufgelegt werden oder als Medikament i.v. gegeben werden (z.B. Tranexamsäure).
Quellen
- Besemer, H., Benner, S. & von Meißner, W. (2015). Pflaster drauf und fertig? – Wundversorgung im Rettungsdienst. retten!, 3(05), 336–344. https://doi.org/10.1055/s-0040-100194
- Enke, K., Flemming, A., Hündorf, H.-P., Knacke, P. G., Lipp, R. & Rupp, P. (Hrsg.). (2015). Lehrbuch für präklinische Notfallmedizin: Patientenversorgung und spezielle Notfallmedizin (5. Aufl., Bd. 1). Edewecht, Niedersachsen: Stumpf + Kossendey. – S. 259-261
- Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. (DGU). (2016, Oktober 26). Kurzversion der S3 – Leitlinie Polytrauma/ Schwerverletzten-Behandlung. Abgerufen 14. Juni 2020, von https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/012-019k_S3_Polytrauma_Schwerverletzten-Behandlung_2017-03.pdf
- Wikimedia Commons (Abb. 1): BoP~commonswiki under CC BY-SA 2.0
- Scientific Animations (Beitragsbild): https://www.scientificanimations.com/wiki-images/ under CC BY-SA